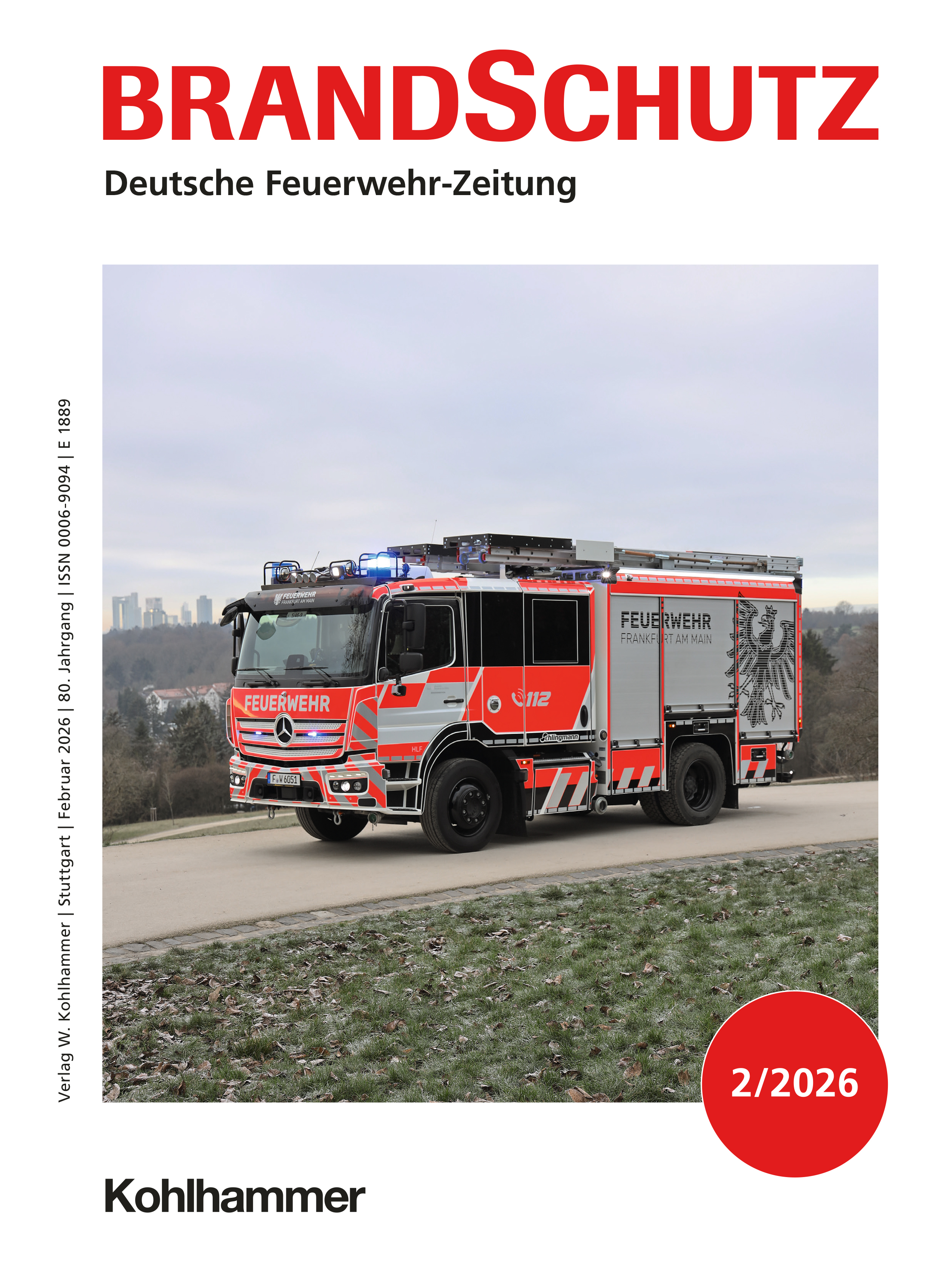Broschüre für den Einsatz bei Lithiumspeichern
Mit einem Solarstromspeicher steht der Strom einer Photovoltaikanlage rund um die Uhr zur Verfügung. So kann man den größten Teil selbst vor Ort verbrauchen. Dies entlastet die Netze, steigert die Unabhängigkeit vom Energieversorger und reduziert die Stromrechnung.
In Deutschland sind nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) bereits etwa 15 000 dezentrale Solarstromspeicher installiert. Ein Teil der verkauften Systeme verwendet klassische Batterien auf Bleibasis. Wachsende Bedeutung erlangen jedoch die relativ neuartigen Lithium-Ionen-Speicher.
Für die Einsatzkräfte der Feuerwehren stellen neueingeführte Technologien in der Regel neue Herausforderungen dar, weil noch kein Erfahrungswissen vorliegt. »Um immer angemessen reagieren zu können, muss man die Besonderheiten jeder Technologie ganz genau kennen. Daher haben wir uns umfassend mit Lithium-Solarstromspeichern auseinandergesetzt«, sagt Roland Goertz, Professor für Sicherheitstechnik und abwehrenden Brandschutz an der Bergischen Universität Wuppertal. Er war Mitglied einer Expertenkommission, welche das neue »Merkblatt für Einsatzkräfte – Einsatz an stationären Lithium- Solarstromspeichern – Hinweise für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung « erstellt hat.
In der Expertenkommission wirkten Fachleute aus sieben Organisationen mit, darunter auch die Bergische Universität Wuppertal, der Deutsche Feuerwehrverband, die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur und der Ergebnisse eigener Untersuchungen haben sie ein dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes Merkblatt für den Einsatz an stationären Lithium-Solarstromspeichern entwickelt.
Die 16-seitige Broschüre, die jetzt veröffentlicht wurde, bietet einen Überblick über verschiedene Batteriesysteme und informiert unter anderem über Aufbau und Funktion der Systeme, über deren Integration in das elektrische Hausnetz sowie über erforderliche Maßnahmen beim Einsatz. In Kürze wird nach Angaben des BSW eine ergänzende Einsatzkarte erscheinen. Das frei verfügbare Merkblatt kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: http://bsw.li/1u5Yqz5
Für die Einsatzkräfte der Feuerwehren stellen neueingeführte Technologien in der Regel neue Herausforderungen dar, weil noch kein Erfahrungswissen vorliegt. »Um immer angemessen reagieren zu können, muss man die Besonderheiten jeder Technologie ganz genau kennen. Daher haben wir uns umfassend mit Lithium-Solarstromspeichern auseinandergesetzt«, sagt Roland Goertz, Professor für Sicherheitstechnik und abwehrenden Brandschutz an der Bergischen Universität Wuppertal. Er war Mitglied einer Expertenkommission, welche das neue »Merkblatt für Einsatzkräfte – Einsatz an stationären Lithium- Solarstromspeichern – Hinweise für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung « erstellt hat.
In der Expertenkommission wirkten Fachleute aus sieben Organisationen mit, darunter auch die Bergische Universität Wuppertal, der Deutsche Feuerwehrverband, die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur und der Ergebnisse eigener Untersuchungen haben sie ein dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes Merkblatt für den Einsatz an stationären Lithium-Solarstromspeichern entwickelt.
Die 16-seitige Broschüre, die jetzt veröffentlicht wurde, bietet einen Überblick über verschiedene Batteriesysteme und informiert unter anderem über Aufbau und Funktion der Systeme, über deren Integration in das elektrische Hausnetz sowie über erforderliche Maßnahmen beim Einsatz. In Kürze wird nach Angaben des BSW eine ergänzende Einsatzkarte erscheinen. Das frei verfügbare Merkblatt kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: http://bsw.li/1u5Yqz5